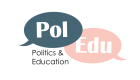Wir alle kennen noch die Bilder vom Flughafen Kabul vom August 2021, von Asylsuchenden auf der griechischen Insel Lesbos oder Flüchtlingsgruppen an den östlichen Grenzen der EU. Diese Bilder schockierten die Öffentlichkeit und riefen großen Protest gegenüber der deutschen Bundesregierung und der EU hervor. Die Forderungen damals waren klar: eine schnelle Aufnahme von möglichst vielen Menschen in der EU oder, auf der anderen Seite der Münze, ein verstärkter Schutz der europäischen Außengrenzen. Dies wird auch in dem jüngsten Konflikt der EU mit Belarus und dessen Präsidenten Lukaschenko deutlich.
Migration ist kein neues Thema für die EU, ganz im Gegenteil: es ist schon immer ein relevantes Thema gewesen, für das es galt, eine möglichst praktikable, menschenrechtskonforme und gleichzeitig für die EU effiziente Lösung zu finden. Wie diese Lösung jedoch aussehen sollte, führte zu divergierenden Meinungen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten. Das Ergebnis dieser Diskussion wurde in den 1990ern der Kompromiss einer Externalisierungsstrategie: Kontrollinstrumente von Massenmigration wurden fortan auf Nicht-EU-Staaten verlagert und enorme Finanzhilfen wurden mobilisiert und an ebendiese Staaten – zumeist benachbarte Staaten der Herkunftsländer – gesendet. Ziel dabei sollte vor allem die Bekämpfung der Fluchtursachen in den Herkunftsgebieten sein. Was jedoch die Folgen dieser Art von Migrationspolitik sein würden, schien damals noch nicht bekannt gewesen zu sein – das gilt sowohl für die außenpolitischen als auch die imagetechnischen Folgen.
Inwiefern sich diese Folgen äußern, lässt sich mit am anschaulichsten anhand des Beispiels rund um den Deal der EU mit der Türkei verdeutlichen. Während sich die EU vor allem mit einem Hauptproblem – der Kontrolle der enormen Flüchtlingsströme in den EU-Schengenraum – konfrontiert sah, bot sich mit der Türkei als einem der Transitländer die Möglichkeit, ihrer Linie der Migrationspolitik Folge zu leisten. Resultat der Verhandlungen zwischen der EU und der Türkei wurde ein Deal, welcher ursprünglich beiden Seiten zugutekommen sollte. Was sich anfangs als gute Kooperation herausstellte, wendete sich im Ende Februar 2020 jedoch in das Gegenteil und Erdogan erpresste die EU gezielt mit der Öffnung der Grenze zu Griechenland und spielte damit seine Überlegenheit in der Flüchtlingsangelegenheit aus. Auch wenn diese Situation wieder geregelt werden konnte, so gab es keine Garantie für erfolgreiche Verhandlungen, zudem sich die EU stets in der benachteiligten Verhandlungsposition befand. Eine ähnliche Situation zeichnet sich auch in dem rezenten Konflikt mit Belarus ab. Nicht nur, dass die EU hier erneut Opfer ihrer eigenen Externalisierungsstrategie geworden ist, sie ist auch in einer untergebenen Verhandlungsposition gegenüber eines eigentlich schwächeren Staates. Ein Grundproblem, welches die beiden Beispiele hier teilen, ist vor allem eines: die Folgen der Externalisierung der Flüchtlingskrise durch die EU. Dies befähigte sowohl die Türkei als auch Belarus, Menschenleben zu instrumentalisieren und somit die Massenmigration zu einer politischen Waffe zu verwandeln.
Heißt das nun, dass die EU alle Migrant*innen hereinlassen soll? Nein. Soll sie jedoch versuchen, ihren Ansprüchen als Repräsentant von Menschenrechten gerecht zu werden? Ja, denn sie hat nicht nur einen internationalen Ruf zu verlieren, sondern auch ihre Integrität zu wahren. Dies sind hohe Ansprüche, keine Frage, und die Lösungsfindung wird stets zwangsläufig in einem Dilemma zwischen Menschenleben und sicheren Grenzen enden.